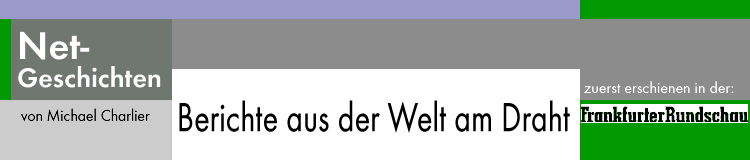
Nicht nur im notorisch prüden Amerika
ist das für Eltern eine Horrorvorstellung: Aus dem global vernetzten
Kinderzimmer tönt vergnügtes Gejohle. Doch die lieben Kleinen
blättern nicht in den ![]() Seiten
mit der Maus und amüsieren sich auch nicht auf
Seiten
mit der Maus und amüsieren sich auch nicht auf ![]() www.disney.de
mit Goofy und Co. Stattdessen begutachtet der hoffnungsvolle Nachwuchs
die enormen Resultate der Silicon-Chirurgie auf Sie-wissen-schon-wo.com
und rätselt über den Realitätsgehalt gymnastischer Paar-Präsentationen
auf Das-würde-ich-mir-nie-ansehen.se. Dem Vater tritt kalter Schweiß
auf die Stirn, doch die frühreifen Surfer, vom TV-Nachmittagsprogramm
vor der Zeit abgehärtet, zappen sich schon zur nächsten Attraktion
des Netzes. Noch wissen sie nicht, ob sie beim fröhlichen Aliens-Abknallen
in einem Online-Spiel landen werden oder bei einem Schiebepuzzle mit ganz
tollen Tierbildern. Süüß.
www.disney.de
mit Goofy und Co. Stattdessen begutachtet der hoffnungsvolle Nachwuchs
die enormen Resultate der Silicon-Chirurgie auf Sie-wissen-schon-wo.com
und rätselt über den Realitätsgehalt gymnastischer Paar-Präsentationen
auf Das-würde-ich-mir-nie-ansehen.se. Dem Vater tritt kalter Schweiß
auf die Stirn, doch die frühreifen Surfer, vom TV-Nachmittagsprogramm
vor der Zeit abgehärtet, zappen sich schon zur nächsten Attraktion
des Netzes. Noch wissen sie nicht, ob sie beim fröhlichen Aliens-Abknallen
in einem Online-Spiel landen werden oder bei einem Schiebepuzzle mit ganz
tollen Tierbildern. Süüß.
Um diesen Unsicherheiten und Ungewissheiten ein Ende
zu bereiten, werden die verschiedensten Filtertechniken angeboten: Sie
sollen das Netz "sauber" halten, so dass man es getrost in jedes
Kinderzimmer und jeden Schulraum lassen kann. Die Idee kommt ursprünglich
aus Amerika, doch auch hierzulande hat sie mächtige Fürsprecher,
insbesondere die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh macht seit Jahren
mit Kongressen und Veröffentlichung enormen Druck. Seit dem Scheitern
des Communications Decency Act 1996 am Einspruch amerikanischer Verfassungsrichter hat sie sogar weltweit die ![]() Führung der Kampagne übernommen.
Führung der Kampagne übernommen.
Koordination scheint auch dringend erforderlich. Es gibt auf dem Markt zwar eine ganze Reihe von Produkten, die besorgten Eltern und Lehrern eine Kontrolle des Onlinekonsums ihrer Schutzbefohlenen erlauben sollen. Sie tragen so freundliche Namen wie "NetNanny", "CYBERsitter" oder auch weniger freundliche wie "CyberPatrol", und sie haben alle eines gemeinsam: Sie sind weitgehend unbrauchbar - zumindest für Anwender auf dieser Seite des Atlantik.
Friedemann Schindler und seine Kollegen von ![]() www.jugendschutz.net
haben bereits vor mehr als einem Jahr eine ausführliche
www.jugendschutz.net
haben bereits vor mehr als einem Jahr eine ausführliche ![]() Studie
zum Thema durchgeführt und dabei Anspruch und Leistung der Programme
kritisch unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich zum einen, dass sie
sehr unzuverlässig sind - deutschsprachige Pornographie wird nur
zu einem geringen Anteil erkannt und gesperrt, Nazi- und Hass-Seiten gehen
fast ungehindert durch. Andererseits blockieren sie auch jede Menge Seiten,
die keinerlei beanstandbaren Inhalte transportieren. Und das schönste:
Auch durchschnittlich computer-fitte Kids ohne besondere Internet-Erfahrung
haben kaum Mühe, den Filter zu entfernen. Bei einem Internet-Workshop
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 - 14 konnten die lieben Kleinen
ohne erwachsene Hilfe alle Filter austricksen - auch den rabiaten "CyberPatrol", der beim Ansurfen "böser" Seiten schon einmal eine laute Alarmsirene einschaltet oder den Computer so gemein abstürzen lässt, dass eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich wird.
Studie
zum Thema durchgeführt und dabei Anspruch und Leistung der Programme
kritisch unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich zum einen, dass sie
sehr unzuverlässig sind - deutschsprachige Pornographie wird nur
zu einem geringen Anteil erkannt und gesperrt, Nazi- und Hass-Seiten gehen
fast ungehindert durch. Andererseits blockieren sie auch jede Menge Seiten,
die keinerlei beanstandbaren Inhalte transportieren. Und das schönste:
Auch durchschnittlich computer-fitte Kids ohne besondere Internet-Erfahrung
haben kaum Mühe, den Filter zu entfernen. Bei einem Internet-Workshop
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 - 14 konnten die lieben Kleinen
ohne erwachsene Hilfe alle Filter austricksen - auch den rabiaten "CyberPatrol", der beim Ansurfen "böser" Seiten schon einmal eine laute Alarmsirene einschaltet oder den Computer so gemein abstürzen lässt, dass eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich wird.
Die Filter arbeiten hauptsächlich nach zwei Methoden: Sie untersuchen
den eingehenden Datenstrom auf "verbotene Wörter" oder
sie blockieren den Zugang zu "schlechten Adressen" (Site-Blocking).
Ersteres kann nur Leuten einfallen, die nicht wissen, was sie tun - und
dann fällt eben auch "Staatsexamen" dem "sex"-Filter
zum Opfer, und die Aufklärungsseite von "ProFamilia" sowieso.
Das zweite ist - in Grenzen - wirkungsvoller, aber auch gefährlicher.
Halbwegs aktuelle Listen von Porno-Servern aufzustellen ist höchst
arbeitsintensiv. Die Listen werden deshalb als teure Betriebsgeheimnisse
verschlüsselt und sind für die Anwender nicht durchschaubar.
Wenn sie aber von ![]() Hackern gekrackt werden, finden sich darauf durchaus nicht nur Adressen von Schmuddelservern, sondern auch von Servern der Bewegung für freie Rede im Internet oder politischen Gegnern. Auf
Hackern gekrackt werden, finden sich darauf durchaus nicht nur Adressen von Schmuddelservern, sondern auch von Servern der Bewegung für freie Rede im Internet oder politischen Gegnern. Auf
![]() www.peacefire.org
wird jeden Tag die Adresse eines Non-Porno-Servers veröffentlicht,
der von den Zensurlisten blockiert wird. Am 6. Januar war es die
www.peacefire.org
wird jeden Tag die Adresse eines Non-Porno-Servers veröffentlicht,
der von den Zensurlisten blockiert wird. Am 6. Januar war es die ![]() National Organization for Women, die auch für die Rechte von Lesbierinnen eintritt.
National Organization for Women, die auch für die Rechte von Lesbierinnen eintritt.
All diese Unschärfen und Grauzonen soll PICS vermeiden. Die unter
Führung der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit AOL, British
Telecom, Microsoft, Network solutions, T-Online, UU-Net und anderen Branchengrößen agierende ![]() "Internet Content Rating Association" hat dieses System entwickelt, das - darauf legen seine Entwickler größten Wert - auf einer "freiwilligen Selbsteinschätzung" der Contentanbieter beruht. Es teilt die Netzwelt in vier Kategorien ein: Gewalt, Sex, Nacktaufnahmen und (ungehörige) Sprache, in jeder Kategorie stehen 5 Stufen zur Verfügung, 0 erlaubt gar nichts und 4 alles. PICS ist bereits heute in die "großen" Browser von Microsoft und Netscape/AOL eingebaut und kann dort jederzeit aktiviert werden.
"Internet Content Rating Association" hat dieses System entwickelt, das - darauf legen seine Entwickler größten Wert - auf einer "freiwilligen Selbsteinschätzung" der Contentanbieter beruht. Es teilt die Netzwelt in vier Kategorien ein: Gewalt, Sex, Nacktaufnahmen und (ungehörige) Sprache, in jeder Kategorie stehen 5 Stufen zur Verfügung, 0 erlaubt gar nichts und 4 alles. PICS ist bereits heute in die "großen" Browser von Microsoft und Netscape/AOL eingebaut und kann dort jederzeit aktiviert werden.
Der Versuch lohnt sich. Kaum hat man den Filter aktiviert, ist das WorldWideWeb verschwunden, zumindest das deutsche. Logischerweise werden alle Seiten ohne PICS-Rating blockiert, und da bleibt nicht allzuviel übrig.
Auf einer ausführlichen Surftour (nicht nur bei Zeitungen) waren
gerade einmal drei ![]() Server aufzufinden, die eine PICS-Klassifikation aufwiesen: www.spiegel.de (Nacktaufnahmen: Stufe 2, Sex: Stufe 1, Gewalt: Stufe 1 und Sprache ebenfalls Stufe 1 - milde Kraftausdrücke). Außerdem www.fazverlag.de und www.taz.de - beide mit 0 in allen vier Kategorien, was bei mindestens einem von den beiden sicher nicht ganz der Wahrheit entspricht. Auch die Server des
Server aufzufinden, die eine PICS-Klassifikation aufwiesen: www.spiegel.de (Nacktaufnahmen: Stufe 2, Sex: Stufe 1, Gewalt: Stufe 1 und Sprache ebenfalls Stufe 1 - milde Kraftausdrücke). Außerdem www.fazverlag.de und www.taz.de - beide mit 0 in allen vier Kategorien, was bei mindestens einem von den beiden sicher nicht ganz der Wahrheit entspricht. Auch die Server des ![]() Bertelsmann-Imperiums von
Bertelsmann-Imperiums von ![]() www.bertelsmannstiftung.de über
www.bertelsmannstiftung.de über ![]() www.stern.de und
www.stern.de und ![]() www.rtl.de bis zu
www.rtl.de bis zu ![]() www.gzsz.de waren ohne Rating - und dabei wäre besonders bei den beiden letzten die Selbsteinschätzung
sicher sehr interessant.
www.gzsz.de waren ohne Rating - und dabei wäre besonders bei den beiden letzten die Selbsteinschätzung
sicher sehr interessant.
Nach Abschluss dieses Artikels stellte sich heraus, daß auch Dr. Web am PICS-System teilnimmt. Das ist nach dem Rating "unbedenklich in allen Kategorien" sicher nicht zu beanstanden - umsomehr aber aus den Gründen, die im Artikel am Fall der TAZ ausgeführt sind.
Trotzdem ist es ein Glück, dass kaum jemand das Rating verwendet - damit bleibt PICS reine Theorie. Und dass die TAZ sich mit 0 in allen Vieren durchmogelt, ist eine ausgesprochene Dummheit: Erstens, weil es sowieso unklug ist, sich dem Zensurverlangen auch nur zum Schein zu unterwerfen, und zweitens, weil geschönte Angaben natürlich den Ruf nach amtlicher Prüfung, Überprüfung, Zertifizierung, Unbedenklichkeitsbescheinigung, kurz, nach dem Internet-Wohlverhaltens-TÜV, hervorrufen müssen.
Denn: Ob die Initiatoren von PICS das nun wahrhaben wollen oder nicht,
der Gedanke einer "freiwilligen" Selbstklassifizierung ist ein
Witz, und das nicht erst, seit das Bundeskriminalamt bei einer ![]() Veranstaltungen
des Hauses Bertelsmann im letzten September mit einer eigenen Vorschlagsliste
von Server-Kennziffern hervorgetreten ist. Wenn PICS oder ähnliche
Systeme auch nur die kleinste Chance haben sollen, wird man das Rating
a) obligatorisch machen und b) seine Korrektheit überwachen müssen.
Veranstaltungen
des Hauses Bertelsmann im letzten September mit einer eigenen Vorschlagsliste
von Server-Kennziffern hervorgetreten ist. Wenn PICS oder ähnliche
Systeme auch nur die kleinste Chance haben sollen, wird man das Rating
a) obligatorisch machen und b) seine Korrektheit überwachen müssen.
Das Internet wäre danach freilich nicht mehr das, was es heute ist.
Es gäbe ein "offizielles" Netz, in dem nur noch die Anbieter
agieren, die das Geld und den Willen haben, ihre Inhalte einem zweifellos
ziemlich teuren Rating zu unterwerfen. Nur noch dieses offizielle Netz
wäre mit den handelsüblichen Browsern erreichbar, das dann,
wie der Zufall es will, den großen e-Kommerz-Häusern und der
Unterhaltungsindustrie einen idealen Kanal für die Ausstrahlung ihrer
Angebote bis ins letzte Kinderzimmer bieten würde. Daneben gäbe
es dann noch eine Art Untergrund-Web, nur mit speziellen Browsern erreichbar
- wenn überhaupt. Schon heute werden von der einschlägigen Industrie
![]() Server
angeboten, die man so einstellen kann, dass sie nur Inhalte mit Rating-Siegel
weitergeben.
Server
angeboten, die man so einstellen kann, dass sie nur Inhalte mit Rating-Siegel
weitergeben.
Dass solche Befürchtungen einen höchst realen Hintergrund haben,
sieht man an den Entwicklungen, die zur Zeit nicht unter dem Etikett des
Jugendschutzes, sondern des Schutzes der Urheberrechte vorangetrieben
werden. Seit einem Jahr wirbt die deutsche Landesgruppe der International
Federation of the Phonographic Industry ( IFPI, unter den prominenten
Mitgliedern insgesamt 5 Bertelsmann-Unternehmen) mit enormem Aufwand für
die Installation ihres ![]() Right-Protection-Systems
RPS). Die etwa 70 deutschen Internet-Provider mit Auslandsleitungen,
so verlangt es die FPI, sollen dieses System übernehmen - auf freiwilliger
Basis, versteht sich. Dann wird bei jedem Aufruf eines Servers im Ausland
automatisch überprüft, ob die angeforderte Seite auf der "Schwarzen
Liste" der Musikindustrie steht - und falls ja, wird die Verbindung
verweigert. Selbstverständlich, so versichert es die IFPI, sollen
nur solche Seiten blockiert werden, auf denen "einzelne MP 3-Songs
mit unerlaubt angebotenen oder gesetzeswidrigen Inhalten" angeboten
werden. Wirkungsvoll kontrollieren kann das niemand. Und wenn das System
erst einmal durchgesetzt ist, werden sich die anderen Interessenten an
schwarzen Listen schon melden.
Right-Protection-Systems
RPS). Die etwa 70 deutschen Internet-Provider mit Auslandsleitungen,
so verlangt es die FPI, sollen dieses System übernehmen - auf freiwilliger
Basis, versteht sich. Dann wird bei jedem Aufruf eines Servers im Ausland
automatisch überprüft, ob die angeforderte Seite auf der "Schwarzen
Liste" der Musikindustrie steht - und falls ja, wird die Verbindung
verweigert. Selbstverständlich, so versichert es die IFPI, sollen
nur solche Seiten blockiert werden, auf denen "einzelne MP 3-Songs
mit unerlaubt angebotenen oder gesetzeswidrigen Inhalten" angeboten
werden. Wirkungsvoll kontrollieren kann das niemand. Und wenn das System
erst einmal durchgesetzt ist, werden sich die anderen Interessenten an
schwarzen Listen schon melden.
Ob diese Filterung technisch wirklich funktionieren kann, ist unsicher
- die Bewegung für Freie Information im Internet ist erfinderisch,
wo es um die Abwehr von Zensur geht. Aber es ist doch einigermaßen
erschütternd, mit welcher Dreistigkeit eine Industrielobby sich ein
Recht zur "Grenzbeschlagnahme" (originalton IFPI) im Internet
anmaßt - und mit welcher wohlwollenden Gleichgültigkeit die
Öffentlichkeit zusieht, wie das Grundrecht des freien Austauschs
von Informationen genau in dem Moment demontiert wird, in dem es erstmals
von allen genutzt werden könnte. ![]()
![]() Dieser lange Text ist natürlich keine Netgeschichte. Aber da er zum Thema gehört und ebenfalls in der FR erschienen ist, passt er hier ganz gut hin.
Dieser lange Text ist natürlich keine Netgeschichte. Aber da er zum Thema gehört und ebenfalls in der FR erschienen ist, passt er hier ganz gut hin.
Aktuelle Links:
© für alle Texte:
Dr. Michael Charlier